
Workshops mit Wirkung
Gute Workshops wirken nachhaltig, weil sie Teilnehmende von Anfang an aktivieren. Die Inhalte werden nicht konsumiert, sie entstehen auf einzigartige Weise im dynamischen Miteinander des Teams.
Der Vorteil: Impulse für Veränderung. Im Denken, in der Wahrnehmung, im Miteinander, in der eigenen Rolle, extern gegenüber Kund:innen und intern zwischen den Abteilungen.
Kurz: live for life.
Wirksam für mehr Resilienz im Stress der VUKA-Welt
Resilienz im Team und das Format Workshop passen perfekt zusammen. Warum? Weil jedes Team seinen ganz individuellen Umgang mit den Themen erkunden, reflektieren und verändern kann.
So entsteht eine Vielfalt an Resilienz-Themen und Anlässen:
- Stress, Stressoren und unser Umgang damit
- Team-Kommunikation und Kundenkommunikation
- Teamleitung und resiliente Führung
- Team-Entwicklung und Team-Stärken
- Umgang mit Konflikten und kommunikative Deeskalation
- Umgang mit Veränderungen (Change)
- Psychische Belastung am Arbeitsplatz
- Krisen, Krankheit und Schicksalsschläge
Fokusfelder für mehr Wirkung im Workshop
Das Problem bestimmt die Intervention und die Auswahl der Methode. Deshalb finden sich hier keine Workshops, sondern Fokusfelder. Also keine Stangenware, sondern Maßkonfektion. Bewährt, aber immer wieder einzigartig passgenau in der Umsetzung. Die Erfahrung zeigt: Jeder Workshop verläuft auf seinen eigenen Pfaden. Das unterscheidet ihn von Schulungen und Trainings.
Am Anfang steht das Problem. So wie im Leben. Im Workshop aktivieren wir die eigenen Ressourcen, wechseln die Perspektiven und finden Lösungen, die wir zuvor alle nicht vermutet hatten.Das macht den Workshop immer wieder spannend und vor allen Dingen einzigartig.
Passgenau wie Maßkonfektion.
So individuell und einzigartig wie die Team-Mitglieder sind auch die Problemwahrnehmungen, Bedürfnisse und Dynamiken. Warum also nicht diese Vielfalt im Workshop nutzen?
Situativ und spezifisch.
Jedes Team befindet sich in einer einzigartigen Situation. Und nicht selten bestehen die Herausforderungen im Team selbst. Warum also nicht gewohnte Denkmuster neu denken?
Proaktiv und lösungsorientiert.
Jedes Team hat schon eine Menge erreicht. Sonst gäbe es dieses Team nicht (mehr). Warum also nicht aus dem lernen, was hilfreich war, um dann den nächsten Schritt zu wagen?
Fokusthema 1
Resiliente Kommunikation im Team
Teams verlieren täglich wertvolle Arbeitszeit durch Missverständnisse und unproduktive Abstimmungsschleifen. Resiliente Kommunikation entwickelt eine authentische Gesprächskultur, die Unterschiede in Wahrnehmung und Meinung als Ressource nutzt statt als Störung zu empfinden. Teams lernen, ihr eigenes Wahrnehmungsmodell zu erkennen und Missverständnisse konstruktiv zu klären, bevor sie Leistung und Zusammenarbeit beeinträchtigen. Aktives Zuhören wird zur Grundhaltung – echtes Interesse am Gegenüber und am gemeinsamen Ziel.
Diese Kommunikationskompetenz wirkt besonders in Transformationsprozessen: Teams entwickeln Flexibilität im Kommunikationsstil, ohne Authentizität zu verlieren. Emotionale Selbstregulation und Reframing-Kompetenz reduzieren Stressbelastung und schaffen psychologische Sicherheit. Das gemeinsame Zielbewusstsein wird gestärkt, Mission und Sinnhaftigkeit werden in der täglichen Kommunikation spürbar. So entsteht eine Kommunikationskultur, die sowohl nach innen als auch nach außen attraktiv wirkt.
- Effizienzsteigerung durch klare Kommunikation: Reduzierte Reibungsverluste in Abstimmungsprozessen und weniger unproduktive Konflikte steigern die Teamleistung messbar
- Change-Kompetenz in Transformationsprozessen: Höhere Anpassungsfähigkeit durch bewusste Reflexion der eigenen Wirkung und flexiblen Umgang mit unterschiedlichen Perspektiven
- BGM-Wirkung für mentale Gesundheit: Präventive Wirkung auf psychische Belastung und Fluktuation durch konstruktives Miteinander und emotionale Selbstregulation
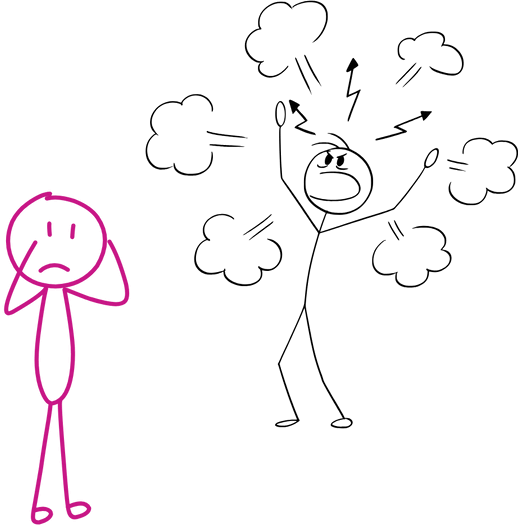
Fokusthema 2
Kundenorientierte Kommunikation
Kundenorientierte Kommunikation geht weit über freundliches Bedienen hinaus: Sie gestaltet Beziehungen und schafft langfristige Bindung. In schwierigen Kundensituationen zeigt sich, ob Teams nur Techniken anwenden oder authentisch und lösungsorientiert agieren können. Der Schlüssel liegt darin, die dahinterliegenden Bedürfnisse zu verstehen und auch unter Druck eine positive Gesprächsatmosphäre zu bewahren. Durch fallbasierte Analyse realer Kundensituationen aus dem Teamalltag entstehen praxisnahe Learnings, die authentisch und nachhaltig wirken.
Diese Kommunikationskompetenz stärkt nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern reduziert auch Stress für die Mitarbeitenden. Teams entwickeln eine gemeinsame Wertehaltung als Basis für konsistentes Auftreten und verbessern die Schnittstellen-Kommunikation zwischen Abteilungen. Kundenorientierung wird zur gelebten Kultur, die sowohl Vertrauen und Loyalität in Umbruchsituationen sichert als auch die Außenwirkung des Unternehmens nachhaltig stärkt.
- Bedürfnisorientierung durch fallbasierte Reflexion: Analyse realer Kundensituationen im Team zur Identifikation hilfreicher Wirkfaktoren und Übertragung auf zukünftige Kontakte
- Empathische Gesprächsführung ohne Floskeln: Emotionen wahrnehmen und angemessen reagieren, Verständnis zeigen ohne den eigenen Standpoint zu verlieren, respektvolle Sprache die Vertrauen fördert
- Stressreduktion und Employer Branding: Weniger Konflikte im Kundenkontakt reduzieren psychische Belastung der Mitarbeitenden und stärken gleichzeitig die Außenwirkung des Unternehmens
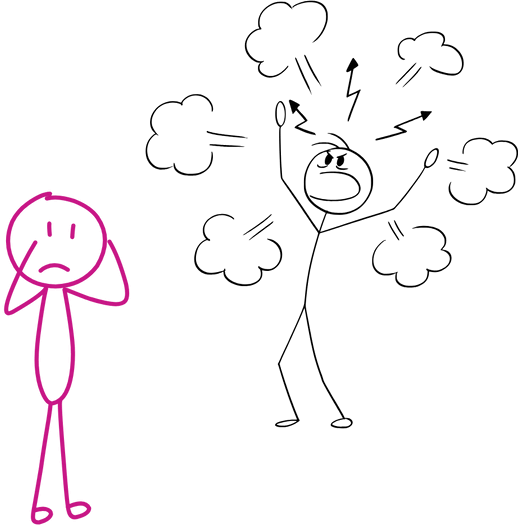
Fokus 3:
Resilienz im Umgang mit Stress
Stress lässt sich im Arbeitsalltag nicht vermeiden – entscheidend ist die Bewertung: Teams, die Stress als Bedrohung sehen, werden gelähmt. Teams, die ihn als Herausforderung wahrnehmen, entwickeln Energie, Fokus und stärkeren Zusammenhalt. Diese moderne Sichtweise geht über das klassische Eustress-/Distress-Denken hinaus und nutzt aktuelle Erkenntnisse der Resilienzforschung. Teams lernen, durch bewusste Reflexion typischer Stressoren aus dem eigenen Arbeitsalltag individuelle und teamorientierte Handlungsoptionen zu entwickeln.
Die Entwicklung einer Beobachterposition ermöglicht es, Stressreaktionen früh zu erkennen und bewusste Entscheidungen zu treffen. Eine systematische Stress- und Ressourcenbilanz identifiziert vorhandene Stärken im Team und schafft gezielte Entlastung. Burnout-Prävention wird zum integrierten Bestandteil einer Kultur, die offene Gespräche über Belastung ermöglicht und Frühwarnsignale ernst nimmt. So entsteht eine attraktive Arbeitsumgebung, die gesunde Leistungsfähigkeit fördert.
- Stress als Wachstumsressource nutzen: Bewertungsänderung von „Bedrohung“ zu „Herausforderung“ steigert Energie, Anpassungsfähigkeit und Teamzusammenhalt messbar
- Burnout-Prävention durch Früherkennung: Systematische Reflexion von Stressoren und Ressourcenbilanz im Team reduziert Ausfallzeiten und stärkt gesunde Leistungsfähigkeit
- Change-Kompetenz in Transformationsprozessen: Resiliente Teams nutzen Druck konstruktiv, steigern Abstimmungsgeschwindigkeit und reduzieren Reibungsverluste in Veränderungsphasen
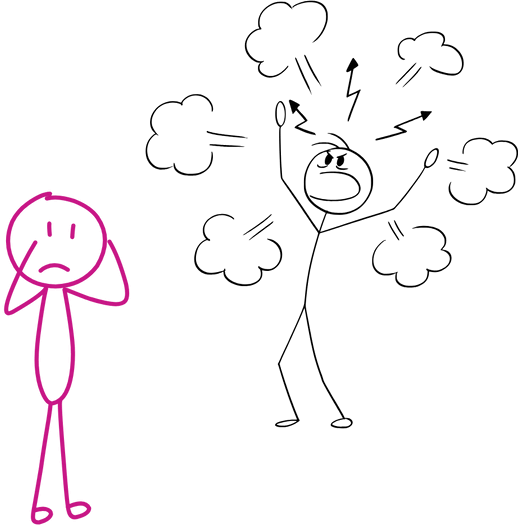
Fokus 4
Beschwerdemenagement als Chance zur Kundenbindung
Bschwerden sind wertvolle Resonanzpunkte mit maximalem Kunden-Involvement – keine lästigen Störfälle. Teams, die Beschwerden als „Einladung zum Dialog“ verstehen, verwandeln potenzielle Kündigungen in intensivere Kundenbeziehungen. Die Haltung entscheidet: Reaktive Schadensbegrenzung schwächt, proaktive Chancenorientierung stärkt sowohl Kundenbindung als auch Markenimage. Durch fallbasierte Analyse realer Beschwerden entwickeln Teams typgerechte Reaktionen und lernen, Kundenbedürfnisse authentisch mit Unternehmensinteressen in Einklang zu bringen.
Professionelles Beschwerdemanagement geht über Schadensausgleich hinaus und entwickelt Angebote, die Kunden überraschen – vom Exklusivservice bis zur persönlichen Einladung. Diese Lösungsorientierung nutzt Beschwerden systematisch als Feedback-System für Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung. Teams reflektieren gemeinsam ihre Haltung zu Fehlern und Feedback, was eine wertschätzende Beschwerdekultur entstehen lässt. Diese wirkt nicht nur auf Kundenloyalität, sondern stärkt auch das Arbeitgeberimage nach innen und außen.
- Proaktive Chancenorientierung statt Schadensbegrenzung: Beschwerden als Change-Impulse nutzen, um Fehlerquellen systematisch zu eliminieren und Prozesse kontinuierlich zu verbessern
- Authentische Lösungsentwicklung ohne Standardfloskeln: Echtes Eingehen auf Anliegen, verletzte Emotionen ernst nehmen und Angebote entwickeln, die über reinen Schadensausgleich hinausgehen
- Kundenbindung durch Überraschungseffekt: Beschwerdeführer als potenzielle Ratgeber sehen und Beschwerdegespräche als Startpunkt für intensivere, langfristige Kundenbeziehungen nutzen
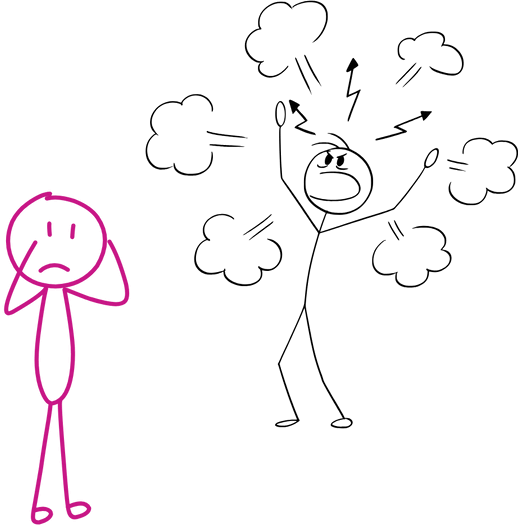
Fokus 5
Umgang mit psychischer Belsatung am Arbeitsplatz
Psychische Belastung am Arbeitsplatz erfordert mehr als Wellness-Programme oder oberflächliche Achtsamkeitskurse. Teams brauchen einen reflexiven, ressourcenorientierten Ansatz, der Belastungssituationen nicht nur reduziert, sondern konstruktiv für Entwicklung und Zusammenarbeit nutzt. Durch klare Differenzierung der Einflussbereiche – von direkt beeinflussbaren Faktoren wie Teamkommunikation bis hin zu nicht veränderbaren Rahmenbedingungen – entstehen realistische Handlungsoptionen. Unterschiedliche Wahrnehmungen von Anforderungen werden reframed und als Ressource für gegenseitiges Verständnis zwischen Führung und Mitarbeitenden genutzt.
Der Ansatz verbindet wissenschaftlich fundierte Modelle wie das Job Demands-Resources-Modell mit praxisnahen Reflexions- und Handlungshilfen. Teams entwickeln eine lösungsorientierte Meetingkultur, die mit bereits funktionierenden Lösungen beginnt und Erfolge systematisch sichtbar macht. Positivpsychologische Impulse fördern Zukunftsorientierung und Growth Mindset, während individuelle Lebenskontexte und Entwicklungsphasen berücksichtigt werden. So entsteht eine ganzheitliche Ressourcennutzung, die psychische Stärken wie Resilienz, Selbstwirksamkeit und Optimismus systematisch aufbaut.
- Einflussbereiche systematisch nutzen:** Klare Differenzierung zwischen direkt beeinflussbaren Teamfaktoren und strukturellen Rahmenbedingungen schafft realistische Handlungsoptionen und reduziert Frustration
- Lösungsorientierte Meetingkultur entwickeln:** Start mit funktionierenden Lösungen statt Problemen, systematisches Sichtbarmachen von Erfolgen und Reframing von Herausforderungen steigert Teammotivation messbar.
- Ganzheitliche Ressourcennutzung statt Symptombekämpfung:** Aufbau psychischer Stärken durch positivpsychologische Impulse und Berücksichtigung individueller Lebenskontexte wirkt nachhaltiger als reine Stressreduktion
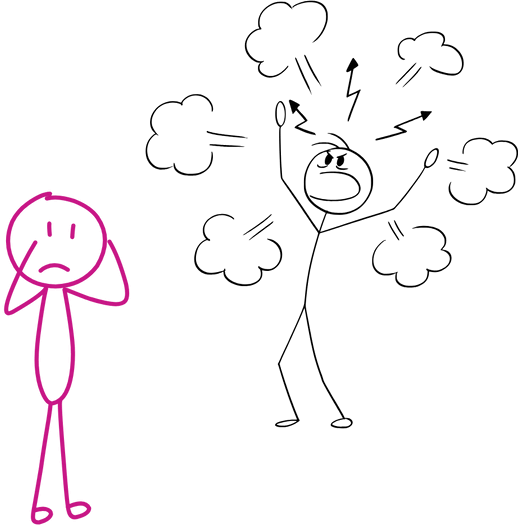
Fokus 6
Change-Kompetenz und Resilienz
Change-Prozesse verlaufen nie nach Lehrbuch – jede Veränderung bringt individuelle Herausforderungen, Dynamiken und Reaktionen mit sich. Teams brauchen mehr als theoretische Phasenmodelle: Sie benötigen moderierte Reflexionsprozesse, die ihre erlebten Veränderungen greifbar machen und Ressourcen sichtbar werden lassen. Der Ansatz führt Teams von extern geleiteter Supervision zu selbstorganisierter Intervision, um die eigene Lernkompetenz zu stärken. Widerstand wird nicht als Störung, sondern als Signal für unausgesprochene Bedürfnisse verstanden und konstruktiv genutzt.
Nachhaltige Change-Kompetenz entsteht durch psychologische Sicherheit und kontinuierliche Begleitung statt einmaliger Events. Teams entwickeln eine konstruktive Fehler- und Lernkultur, die Unsicherheiten reduziert und Selbstwirksamkeit stärkt. Mitarbeitende werden aktiv in Lösungsfindung eingebunden, wodurch Veränderungen als Wachstumschance erlebt werden. Diese Herangehensweise wirkt als BGM-Maßnahme zur Stressreduktion und positioniert das Unternehmen als veränderungskompetent und mitarbeiterorientiert.
- Von Supervision zu Intervision: Gradueller Übergang von extern moderierter Reflexion zu selbstorganisierter Teamkompetenz stärkt langfristige Anpassungsfähigkeit und reduziert Abhängigkeit von externen Impulsen
- Widerstand als Ressource nutzen: Systematisches Verstehen von Widerstand als Signal für Bedürfnisse und fehlende Informationen verwandelt Blockaden in konstruktive Entwicklungsimpulse
- BGM-Wirkung in Transformationsphasen:** Kontinuierliche Reflexionsbegleitung reduziert Fluktuation und Fehlzeiten während Veränderungsprozessen und erhöht nachhaltig die Teamkohäsion
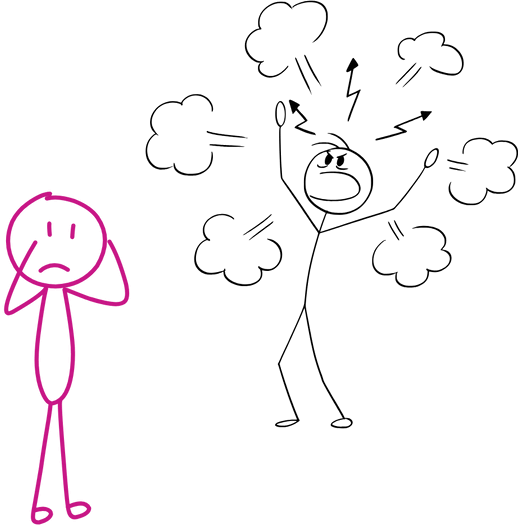
Fokus 7
Teamkultur und Zusammenarbeit
Eine starke Teamkultur entsteht nicht durch Team-Events oder motivierende Poster, sondern durch bewusst gestaltete Kommunikationsrituale und Arbeitsabläufe. Teams brauchen eine gemeinsame Wertebasis mit klarer Zielausrichtung, die unterschiedliche Perspektiven als Bereicherung nutzt, ohne den Fokus auf das gemeinsame Ziel zu verlieren. Workshops schaffen geschützte Erfahrungsräume, in denen Teams neue Dynamiken erleben und reflektieren können – weit entfernt vom Alltagsstress und den gewohnten Denkmustern.
Konfliktprävention funktioniert durch frühzeitiges Ansprechen von Unstimmigkeiten und das Sichtbarmachen verdeckter Spannungen. Authentische Wertschätzung wird systematisch etabliert – beispielsweise durch „Kompetenzdusche“ als Ritual zur expliziten Anerkennung von Stärken. Rollenklarheit sorgt dafür, dass jeder seinen Beitrag zum Gesamterfolg kennt, während bewusste Durchmischung der Gruppen Grüppchenbildung verhindert. Verbindliche Teamvereinbarungen und eine konstruktive Feedbackkultur schaffen verlässliche Orientierung für nachhaltigen Zusammenhalt.
- Authentische Wertschätzung steigert Engagement: Systematische Anerkennung von Kompetenzen durch konkrete Rituale wie „Kompetenzdusche“ erhöht Motivation und reduziert Fluktuation messbar
- Konfliktprävention spart Zeit und Geld: Frühzeitiges Ansprechen von Unstimmigkeiten verhindert kostenintensive Eskalationen und reduziert den Aufwand für nachgelagerte Konfliktbearbeitung
- Unterschiedliche Perspektiven als Innovationsmotor: Bewusste Durchmischung und Rollenklarheit bringen verschiedene Denkweisen produktiv zusammen und erhöhen die Problemlösungsgeschwindigkeit des Teams
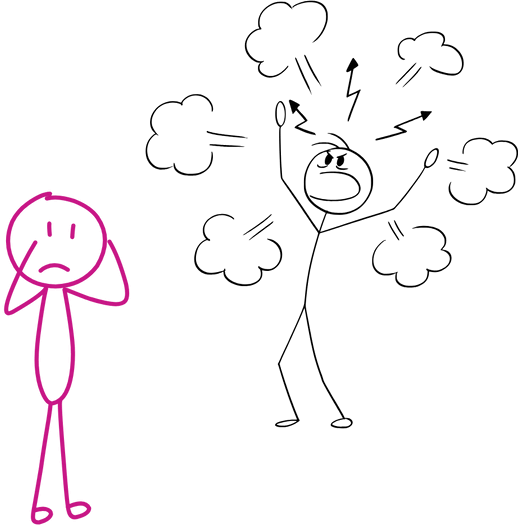
Fokus 8
Resilenz und Patientenkommunikation
Patientenkommunikation im Gesundheitswesen bringt täglich emotionale Herausforderungen mit sich – von Ängsten und Sorgen bis hin zu offenen Konflikten. Teams brauchen mehr als Gesprächstechniken: Sie benötigen eine empathische Grundhaltung, die echtes Interesse zeigt und auch nonverbal Wertschätzung ausdrückt. Durch aktives Zuhören, Bedürfnisklärung und den bewussten Verzicht auf Fachjargon entstehen Gespräche, die Vertrauen aufbauen statt Distanz zu schaffen. Die Stärkung der Gesundheitskompetenz von Patienten – durch portionierte Informationen, Teach-Back-Methoden und Visualisierungen – reduziert Missverständnisse und fördert die Therapiemitarbeit.
Resiliente Patientenkommunikation bedeutet auch, schwierige Emotionen wie Ängste und Ärger anzusprechen und zu validieren, ohne sie zu bagatellisieren. Shared Decision Making bezieht Patienten aktiv in Entscheidungen ein und macht Optionen transparent. Deeskalationsstrategien helfen dabei, ruhig zu bleiben und Gespräche auf die Lösungsebene zu lenken. Kulturelle Sensibilität und die Anwendung bewährter Gesprächsmodelle wie SPIKES schaffen Orientierung in komplexen Situationen. Selbstfürsorge und klare Rollengrenzen schützen vor emotionaler Überlastung und sichern die professionelle Handlungsfähigkeit.
- Vertrauensaufbau durch empathische Grundhaltung: Echtes Interesse und nonverbale Kongruenz reduzieren Patientenängste und verbessern die Therapiecompliance messbar
- Deeskalation und Emotionsmanagement: Professioneller Umgang mit Ängsten und Ärger durch Validierung und Lösungsorientierung verhindert Eskalationen und entlastet das Personal emotional
- Gesundheitskompetenz als Präventionsfaktor: Verständliche Kommunikation, Teach-Back-Methoden und Shared Decision Making reduzieren Rückfragen, Beschwerden und Behandlungsfehler
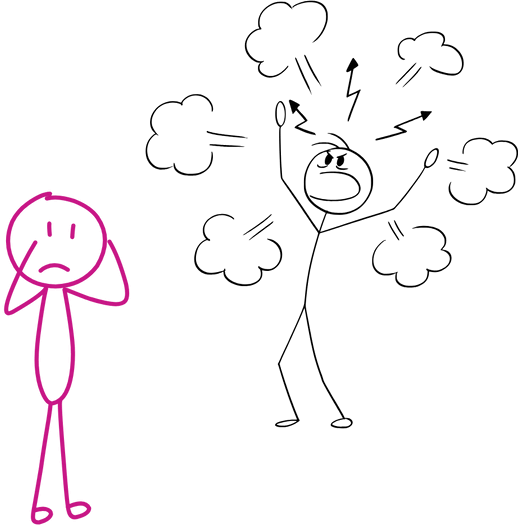
Perspektivenwechel – kreaktiv!
Perspektivenwechsel wird im Arbeitsalltag selten aktiv praktiziert, obwohl er Schlüsselkompetenz für bessere Entscheidungen und weniger Konflikte ist. Teams lernen, bewusst mindestens eine hilfreiche und eine schädliche Perspektive zu jeder Situation zu identifizieren – und gezielt die förderlichen Sichtweisen auszuwählen. Dieser Fokusbereich bietet die Möglichkeit, eingefahrene Routinen und Rollenmuster in Meetings zu hinterfragen und neue Betrachtungsweisen zu erproben. Praktische Tools wie Rollentausch, Stakeholder-Mapping und das Einnehmen einer „dritten Position“ werden systematisch entwickelt und für den Alltag nutzbar gemacht.
Diese Teamkompetenz verbessert sowohl interne Abstimmungen als auch externe Beziehungen zu Kunden, Patienten und anderen Abteilungen. Kreativität und Lösungsvielfalt entstehen durch ungewohnte Betrachtungsweisen, während systemisches Denken und gemeinsame Zielorientierung gestärkt werden. Die Flexibilität im Denken unterstützt als Resilienzfaktor die Anpassung an Veränderungen und wirkt präventiv gegen Eskalationen und Konfliktverhärtung. Kurze Reflexionsroutinen und Check-Fragen lassen sich in bestehende Meetings integrieren, um den nachhaltigen Transfer in den Arbeitsalltag zu sichern.
- Kreativität und Lösungsvielfalt durch systematische Perspektivarbeit: Bewusstes Identifizieren hilfreicher und schädlicher Sichtweisen erhöht die Entscheidungsqualität und erschließt neue Handlungsoptionen
- Konfliktprävention durch Routinen-Hinterfragung: Aufbrechen eingefahrener Rollenmuster reduziert Eskalationen und Konfliktverhärtung nachhaltig
- Systemisches Denken für bessere Beziehungsqualität: Perspektivenwechsel als Teamkompetenz verbessert sowohl interne Abstimmungen als auch externe Beziehungen zu Kunden und anderen Abteilungen messbar
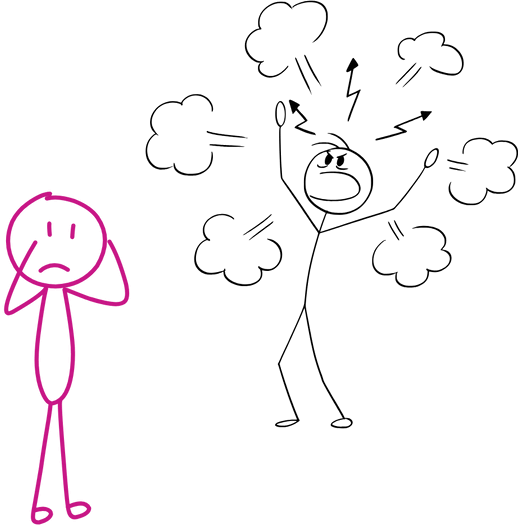
Feedback mit Wirkung für selbstlernende Teams
Feedback scheitert oft an oberflächlichen Techniken und „Lippenbekenntnis-Komplimenten“, die Vertrauen untergraben statt aufzubauen. Wirksames Feedback basiert auf Authentizität vor Technik – es muss ehrlich, glaubwürdig und wertschätzend sein. Teams entwickeln klare Feedbackprinzipien durch Ich-Botschaften, Beobachtung statt Bewertung und zeitnahe, spezifische Rückmeldungen. Die doppelte Blickrichtung bezieht sowohl positives als auch kritisches Feedback ein, um Stärken zu festigen und Entwicklungsfelder zu öffnen.
Feedback wird zum Dialog – ein gemeinsamer Erkenntnisprozess statt einseitiger Ansprache. Diese Herangehensweise fördert eine Lernkultur als Grundhaltung, in der Veränderungen als Chance gesehen und Fehler nicht verschwiegen oder sanktioniert, sondern konstruktiv ausgewertet werden. Führung lebt Feedbackannahme und Lernbereitschaft aktiv vor, während Teams gemeinsame Lernrituale wie monatliche Lernrunden, Retrospektiven oder Peer-Coaching etablieren. Aus Feedback abgeleitete Maßnahmen werden direkt in Teamprozesse integriert, wodurch kontinuierliche Weiterentwicklung zur gelebten Praxis wird.
- Authentizität als Vertrauensgrundlage: Ehrliche, wertschätzende Rückmeldungen statt formelhafter Techniken schaffen die Basis für offene Lernkultur und nachhaltige Verhaltensänderungen
- Fehlerfreundlichkeit für Innovation: Konstruktive Auswertung von Fehlern statt Sanktionierung fördert Risikobereitschaft und beschleunigt Lernprozesse messbar
- Integrierte Lernrituale: Systematische Verzahnung von Feedback und Teamprozessen durch Retrospektiven und Peer-Coaching entwickelt selbstlernende Teams, die weniger externe Steuerung benötigen
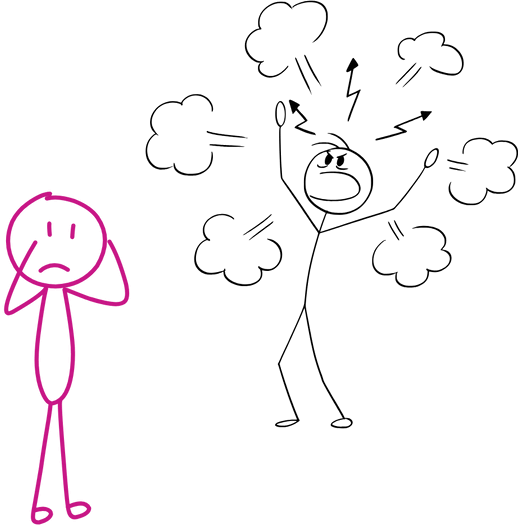
Begleitung von Teams bei akuten Belastungssituationen
Wenn Teams durch den plötzlichen Tod eines geschätzten Mitarbeiters oder einer Führungskraft in akute Belastung geraten, brauchen sie mehr als professionelle Krisenintervention allein. Dieser Fokusbereich bietet gezielte Unterstützung dort, wo deren Kapazitäten enden – mit dem Ziel, Handlungsfähigkeit zu erhalten, Stabilisierung zu schaffen und behutsame Verarbeitung im Teamkontext zu ermöglichen. In der Phase der Schockreaktion, in der Teams oft sprachlos, gelähmt oder überfordert sind, entstehen sichere, wertfreie Gesprächsräume mit klarer emotionaler Orientierung.
Die Moderationsrolle entlastet Führungskräfte, die selbst betroffen sind, und unterstützt bei der Wortfindung für angemessene Gesprächssituationen. Zentrale Elemente umfassen Stabilisierung durch Präsenz und Orientierung, symbolische Handlungen wie Gedenkminuten oder Erinnerungsbücher, das Teilen von Erinnerungen zur Würdigung des Verstorbenen sowie die Unterstützung beim Ausdrücken von Gefühlen. Ressourcenaktivierung betont, was das Team bisher getragen hat und stärkt den Zusammenhalt. Ein hoffnungsvoller Blick nach vorne hilft dabei, Kraft zu schöpfen und Perspektiven aufzuzeigen.
- Stabilisierung in Schockphasen: Präsenz und emotionale Orientierung reduzieren akute Überforderung und schaffen Struktur, wenn Teams sprachlos oder gelähmt sind
- Entlastung betroffener Führungskräfte: Professionelle Moderationsrolle übernimmt schwierige Gesprächsführung und unterstützt bei angemessener Wortfindung in belastenden Situationen
- Nachhaltige Kultur der gemeinsamen Bewältigung: Förderung einer Teamkultur, in der auch schwere Verluste gemeinsam getragen werden, ohne dass Einzelne isoliert zurückbleiben
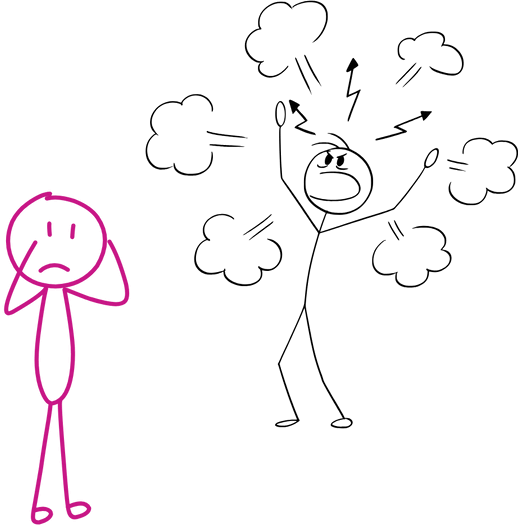
Resilient führen
Führung in der VUKA-Welt erfordert mehr als klassische Management-Techniken – sie braucht authentische Persönlichkeit und individuelle Rollenfindung. Führungskräfte entwickeln ihr eigenes Rollenverständnis, indem sie persönliche Stärken und Merkmale bewusst in die Führungsrolle einbringen, statt einem „Einheitsprofil“ zu folgen. Kommunikationskompetenz wird zum Schlüssel: klare, wertschätzende und lösungsorientierte Gespräche im Team und abteilungsübergreifend, transparenter Informationsfluss und die Fähigkeit, durch aktives Zuhören und gezielte Fragen echte Verbindungen zu schaffen.
Der Fokus liegt auf einer Coaching-Haltung, die Teammitglieder befähigt und fördert statt kontrolliert. Stärkenorientierung ersetzt Defizitfokus, während das Team auf gemeinsame Ziele ausgerichtet wird. Delegationskompetenz bedeutet loslassen können und Vertrauen in die Teammitglieder aufzubauen – Delegation wird zur Entwicklungschance. Selbstführung und Resilienz bilden das Fundament: eigene Belastungsgrenzen kennen, Stressmanagement-Strategien anwenden und regelmäßige Selbstreflexion praktizieren. Change-Kompetenz zeigt sich in der Fähigkeit, Veränderungsprozesse zu moderieren, Teams in Entscheidungen einzubeziehen und durch Storytelling Sinn zu vermitteln.
- Authentische Führungspersönlichkeit als Erfolgsfaktor:** Individuelles Rollenverständnis und persönliche Stärkenintegration schaffen glaubwürdige Führung, die Mitarbeiterengagement und Vertrauen nachhaltig steigert
- Coaching-Haltung für Teamentwicklung:** Stärkenorientierte Führung und professionelle Delegationskompetenz entwickeln selbstständige Teams und reduzieren den Steuerungsaufwand für Führungskräfte
- Change-Kompetenz als BGM-Maßnahme:** Führung als Schlüsselfaktor für gesunde Arbeitskultur wirkt präventiv auf psychische Belastung und positioniert das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber
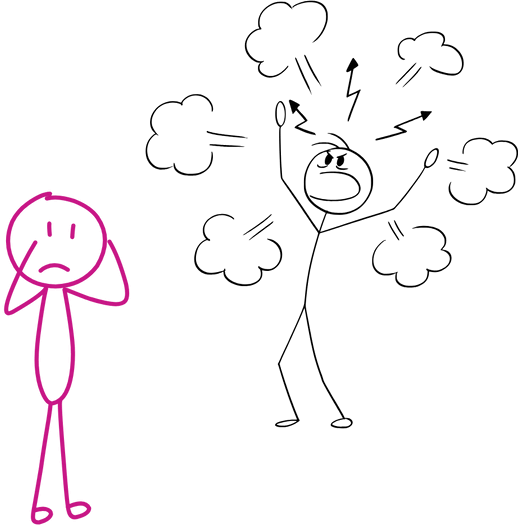
Selbstbestimmt reflektieren statt instruieren.
Von der Management-Funktion bis zu den Herausforderungen der Ausbildung. Resiliente Teams sind effektiv, loyal, konstruktiv und
Von Anfang Fokus auf die eigenen Ressourcen und Stärken
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.
Passgenaue Micro-Inputs für den selbstwirksamen Praxistransfer
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.
Nachhaltiges Verständnis für das eigene Konfliktverhalten
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley.
Mehr Resilienz durch die Ressourcenbrille
Workshops sind aktiv, proaktiv und interaktiv. Das sind nicht zufällig zugleich wichtige Resilienzfaktoren. Willkommen in der Arena! Wir setzen uns immer wieder die Ressourcenbrille auf und entdecken Neuland, ohne dabei den Raum zu verlassen. Außer in den Pausen.
So funktioniert Resilienz nicht
Einige Anbieter verkaufen Resilienz wie eine Checkliste zum Abhaken: „Lernen Sie ein paar Resilienzfaktoren, sammeln Sie Tools und Techniken, dann sind Sie fit für jede Krise.“ Die Veranstaltung ist dann beendet und vom nächsten Tag an sollen alle resilienter sein?
Das ist ein Mythos. Resilienz lässt sich nicht auf Vorrat beschaffen und bei Bedarf abrufen. Standard-Workshops mit Basis-Rezepten funktionieren nicht, weil sie die Einzigartigkeit jedes Teams ignorieren.
Der Paradigmenwechsel
Echte Resilienz entsteht nicht durch trainiertes Wissen, sondern durch die Fertigkeit der Teilnehmenden, hilfreiche Perspektiven zu entwickeln. Also kein Dozieren mit vorgefertigten Antworten. Lehrbücher kann jeder selbst lesen.
Stattdessen hilfreiche Fragen für nutzbare Denkprozesse in der eigenen Team-Praxis. Das macht jeden Workshop einzigartig spannend. Weil wir im eigenen Team Ressourcen und Stärken entdecken, die wir bislang übersehen hatten.
Aha-Effekte statt Problemdenken
Die Problemwelt kennen alle bereits. Die haben wir jeden Tag trainiert und integriert. Ob im Umgang mit Stress, psychischen Belastungen oder schwierigen Situationen. – Die Problemwelt ist so verlockend gewohnt.
Was ist in diesen Workshops anders? Die unerwarteten Erkenntnisse, die in blinden Flecken verborgen waren. Wir beginnen in der Lösungswelt. Vielleicht ein Kulturschock? Prima!
Diese Workshops sind gefährlich!
Ein Warnhinweis und Disclaimer: Diese Art von Workshops ist eine Gefahr für gewohnte Schemata, Komfortzonen, Jammer-Trancen und die Vergangenheit.
Auf einmal wird deutllich warum vieles „funktioniert“: Konflikte, Eskalationen, Stresserleben, Frust, unendliche Diskussionen, Krankheit. Ja, das funktioniert! Was „funktioniert“, muss aber nicht immer hilfreich sein. Mehr dazu im Workshop.
